Die antike Siedlung Tharros befindet sich am südlichen Ende der Sinis-Halbinsel. Es entfaltet sich im Golf von Oristano auf einer Art natürlichem Amphitheater, das im Norden durch den Hügel Su Muru Mannu, im W durch den Turm von San Giovanni und S durch die Landenge begrenzt wird, die letztere mit dem Vorgebirge von Capo San Marco verbindet.
Der Besuch der römischen Überreste von Tharros kann mit der Kanalisierung in das „Opus Mixtum“ beginnen, das Teil des Wasserversorgungssystems der Stadt ist, hinter der Kirche San Giovanni. Dann nehmen Sie die Römerstraße mit ihrem typischen Basaltpflaster, flankiert von Gebäuderesten.
Nachdem Sie der Straße gefolgt sind, biegen Sie nach Süden zum „Cardo Maximus“ ab. In N, auf dem Hügel von Su Muru Mannu, befindet sich ein Tempel, der vielleicht Demeter gewidmet ist. Es wurde in der punischen Zeit gegründet und in römischer Zeit in ein dreigliedriges Gebäude mit Nebenräumen umgewandelt.
Wir erreichen das „Amphitheater“, ein spätromanisches Rundbauwerk, das von einer Höhle (m 32 x 30) umgeben ist, und zum Tofet mit den heute noch vorhandenen Überresten des nuraghischen Dorfes. Dann erreicht man die N-Befestigungsanlagen, die eine punische Phase und eine römisch-republikanische Phase aufweisen.
Wir gehen rückwärts entlang des 'Cardo Maximus' und erreichen das 'Castellum Aquae', den Hauptwassertank der Stadt. Es ist rechteckig (13,8 x 11,5 m) und wurde in „opus mixtum“ erbaut. Der Innenraum, der in drei Schiffe mit 8 Säulen unterteilt ist, von denen 4 in der Mitte liegen, hat einen Cocciopesto-Boden.
Wenn Sie die Straße zum Meer entlang fahren, können Sie ein Wohnviertel sehen. Auf der anderen Seite können Sie ein gemischtes Gebäude sehen, das aufgrund des Reichtums des Putzes, des Vorhandenseins eines Brunnens und der planimetrischen Anordnung als thermischer Komplex erkennbar ist: Es besteht aus einer rechteckigen Umgebung, auf der sich zwei Räume öffnen, die in apsidische Umgebungen führen.
Hinter den Bädern, wenn man nach dem „Tempel der ägyptischen Schluchten“ weitergeht und nach oben biegt, kann man ein weiteres Thermalgebäude aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. sehen; die Umkleidekabine, das „Tepidarium“, das „Calidarium“ und zwei Räume, in denen ein Tank errichtet wurde, sind erhalten geblieben. In N befindet sich die „Ecclesia sancti Marci“, das Zentrum eines Gebietes mit verschiedenen Bauzeugen aus der Spätantike.
Wenn man die asphaltierte Straße entlang nach S zurückgeht, kann man die Überreste des „monumentalen Tempels“ bewundern, der auf der N/O- und N/E-Seite mit einer mächtigen Zaunmauer in Isodombauweise ausgestattet und auf den anderen Seiten in den Sandstein gehauen ist (m 34 x 16). Die erste Phase des Heiligtums stammt aus dem 4./3. Jahrhundert vor Christus. Eine stufenförmige Rampe führte zum rechteckigen Altar, dessen Erhebung mit dorischen Halbsäulen geschmückt war. Neben dem Gebäude, auf der S-Seite, öffnete sich ein Ritualtank.
Noch weiter südlich erreichen wir den „Tempel mit semitischem Grundriss“, bei dem eine der vier Seiten in die Felsenbank geschnitten ist; er besitzt ein polychromes Bodenmosaik aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus.
Dann erreichen wir den „Bereich der zwei Säulen“, von dem eine von einer korintherisch-italischen Hauptstadt dominiert wird. Das Gebiet ist voller Überreste, die schwer zu identifizieren sind, mit Ausnahme eines kleinen Tempels im spätrepublikanischen Stil mit zwei Säulen an der Vorderseite und einer Zugangsrampe mit fünf Stufen.
In S ist der unruhige Küstenabschnitt das, was vom Hafengebiet übrig geblieben ist. In derselben Richtung stellen die „Bäder des alten Klosters“ den reichsten Thermalkomplex der Stadt dar, der auf das Ende des zweiten Jahrhunderts n. Chr. zurückgeht. Sie besteht aus „Opus Mixtum“ und Ziegeln und ist auf drei Ebenen angeordnet: vom „Apodyterium“ mit einer gemauerten Theke und dreieckigen Gehäusen gehen wir weiter zum „Frigidarium“ mit zwei ursprünglich Mosaikbecken; dann zu den drei „Calidaria“, die die „Suspensurae“ bei Besalen hervorheben, auf denen der Boden ruhte.
In Richtung N erreicht man das Forum, einen dreieckigen, mit Basalt gepflasterten Platz mit angrenzenden Wohnbereichen. Die Häuser hatten ein Zugangsfach, dem die Zimmer zugewandt waren. Manchmal gab es ein Obergeschoss. Die Geschäfte befanden sich in einer einzigen Umgebung.
Bei S/O gibt es viereckige Kellerbauten (Restbetrag h m 3,50). Eine kaiserliche römische Nekropole befindet sich nördlich des Tofet hinter den römischen Befestigungsanlagen.
Geschichte der Ausgrabungen
Die Untersuchungen der Stätte begannen 1838 durch den Marquis Scotti und den Jesuiten Perotti. Im Jahr 1842 bereicherte eine vom König von Sardinien, Carlo Alberto, in Auftrag gegebene Ausgrabung die königlichen Sammlungen von Turin mit Goldmünzen, Juwelen und Skarabäen. Dank des Königs wurde das Verbot geheimer Ausgrabungen zur illegalen Bereicherung durchgesetzt. 1851 grub Lord Vernon, ein Engländer, der auf der „Grand Tour“ durch Italien war, 14 Gräber in der unterirdischen Kammer und fand unter anderem viele Juwelen, die er mit nach England nahm. Die Entdeckungen weckten das Interesse der Einwohner des nahe gelegenen Cabras, die etwa 500 Gräber verletzten. 1860 entdeckte der damalige Direktor des Cagliari-Museums, Gaetano Cara, einige punische Gräber mit reichen Gegenständen, die er stahl und den wichtigsten Museen Europas anbot und sie schließlich an das British Museum in London verkaufte. Von 1956 bis 1964 brachte Gennaro Pesce einen Teil der Stadt östlich des Turms von San Giovanni und im Norden den Bereich des Tofets ans Licht. Ferruccio Barreca identifizierte 1958 den kleinen Tempel am Ende von Capo San Marco und setzte von 1969 bis 1973 die Ausgrabungen der Stadt, der Befestigungsanlagen und des Tophets fort. Letzteres Gebiet wurde in Zusammenarbeit mit Enrico Acquaro untersucht.
Bibliographie
G. Pesce, „Tharros“, in Encyclopedia of Ancient, Classical and Oriental Art, VI, Rom, 1966, S. 800-806; E. Acquaro - C. Finzi, Tharros. Sassari, C. Delfino, 1986 (Archäologisches Sardinien. Führer und Reiserouten; 5); R.D. Barnett-C. Mendleson, Tharros. Ein Materialkatalog im British Museum aus Phoenician and Other Tombs at Tharros, Sardinia, London, British Museum, 1987;
M. Falchi, „Analysis of the urban configuration of Tharros“, in Tharros, herausgegeben von P. Desogus, Nuoro, 1991, S. 23-37;
R. Zucca, Tharros, Oristano, G. Corrias, 1993; C. Del Vais, The Third Life of Tharros, Die geplünderte Stadt, „Darwin. Notizbücher“, Nr. 1 (Juli-August 2006), S. 76-85.
Anfahrt
Vom Weiler San Giovanni di Sinis fahren Sie auf der SP 6 etwa 1 km in Richtung S weiter.
Inhaltstyp:
Archäologischer Komplex
Archäologie
Provinz: Oristano
Gemeinsam: Cabras
Makrogebiet: Zentral-Sardinien
POSTLEITZAHL: 09072
Adresse: SP 6 - località Tharros, San Giovanni di Sinis
Webseite: www.tharros.sardegna.it/info-e-prenotazioni/orari-e-modalita-di-visita-di-tharros
Aktualisieren
Wo ist es
Bilder
Video
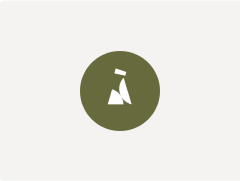

Autor : Floris Laura
Ergebnisse 2 von 47570
Alle ansehen
Kommentare